Alles rund um das Therapiegebiet RSV

Sie sind vom Respiratorischen Synzytial-Virus (RSV) betroffen und auf der Suche nach neuen Behandlungsmöglichkeiten? Mit einer Teilnahme an einer klinischen Studie leisten Sie einen wertvollen Beitrag zur RSV-Forschung und können die neuesten Therapien für sich selbst nutzen.
Inhaltsverzeichnis:
1. Was ist die RSV-Krankheit?
2. Was sind typische RSV-Symptome?
3. Wie entsteht eine RSV-Erkrankung?
4. Derzeitige Behandlungsmöglichkeiten des RS-Virus
5. Aktueller Forschungsstand zum RS-Virus
6. Klinische Studien zum RSV – häufig gestellte Fragen
1. Was ist die RSV-Krankheit?
Das RS-Virus (Respiratorisches Synzytial-Virus) ist ein Erreger, der akute Erkrankungen der oberen und unteren Atemwegehervorruft. Er sorgt dafür, dass die Zellen im Atemtrakt miteinander verschmelzen (Synzytien). Das kann zu einer Bronchitis, einer Lungenentzündung oder einer Bronchiolitis führen.
Wer erkrankt am RS-Virus?
RSV kommt weltweit vor und verursacht saisonale Krankheitsausbrüche (in unseren Breiten zwischen November und April). Menschen jeden Alters können am RS-Virus erkranken. Kleinkinder sind jedoch besonders anfällig, da unreife Lungen ein Risikofaktor für schwere Atemwegsinfekte sind. Im ersten Lebensjahr erkranken 50 bis 70 % am RS-Virus, nach dem zweiten Lebensjahr hatte fast jedes Kind bereits eine RS-Virus-Infektion.
2. Was sind typische RSV-Symptome?
Die Symptome der RSV-Erkrankung können je nach Patient:in unterschiedlich ausfallen. Sie ähneln meist denen einer Erkältung.
Typische RSV-Anzeichen sind:
- Schnupfen
- trockener Husten
- Niesen
- Halsschmerzen
- Fieber
- Keuchatmung
Bei ansonsten gesunden Erwachsenen mit RSV gibt es häufig auch asymptomatische Verläufe, bei denen keine Beschwerden auftreten. Bei kleinen Kindern kann es jedoch zu schweren Verläufen mit Atemnot und Atemstillstand kommen.
Da eine Infektion mit dem RS-Virus nur schwer von anderen Erkrankungen der Atemwege zu unterscheiden ist, sollten Eltern ihr Kind bei grippeähnlichen Symptomen sowie bei Atemnot oder Fieber ärztlich untersuchen lassen.
3. Wie entsteht eine RSV-Erkrankung?
Die Ansteckung mit dem RS-Virus verläuft ähnlich wie bei anderen viralen Atemwegserkrankungen. Das Virus wird über Tröpfchen oder als Schmierinfektion von Mensch zu Mensch oder über kontaminierte Gegenstände übertragen.
Wenn der Erreger auf die Schleimhäute gelangt, kann er eine Erkrankung auslösen. Die Inkubationszeit beträgt ca. 2–8 Tage, die Dauer der Ansteckungsfähigkeit ca. 3–8 Tage.
Das Risiko für einen schweren Verlauf steigt durch eine Reihe von Faktoren. Ein höheres Risiko besteht bei:
- Frühgeborenen
- Säuglingen
- Neugeborenen und Kleinkindern mit chronischen Lungenerkrankungen, angeborenen Herzfehlern oder Trisomie 21
- Mehrlingsgeburten
- Männern
- Menschen in Raucher-Haushalten
- Angehörigen von Menschen mit Vorerkrankungen wie Heuschnupfen, Neurodermitis oder Asthma
Warum trat das RS-Virus nach der Corona-Pandemie besonders häufig auf?
Zum Ende der Corona-Pandemie stiegen die Erkrankungen mit dem RS-Virus bei Neugeborenen und Säuglingen stark an. Im Winter 2022 wurden fünfmal mehr Infektionen registriert als im Winter des Jahres 2018. Viermal so viele Betroffene mussten auf Intensivstationen behandelt werden. Expert:innen sehen unter anderem die Kontaktverbote und Schließungen von Kitas als Ursache dafür, dass das Immunsystem vieler Kinder nicht trainiert werden konnte. Die RSV-Welle sei nach Lockerung der Beschränkungen daher besonders stark ausgefallen.
4. Derzeitige Behandlungsmöglichkeiten des RS-Virus
Das Virus lässt sich zum jetzigen Stand der Forschung nicht direkt bekämpfen. Die Möglichkeiten beschränken sich daher auf eine symptomatische Behandlung der RSV-Erkrankung. Dazu zählen:
- ausreichende Flüssigkeitszufuhr
- Nasenspülung
- fiebersenkende Medikamente
- abschwellende Nasensprays
- bronchienerweiternde Mittel
Neugeborene, die sich mit dem RS-Virus infizieren, müssen möglicherweise im Krankenhaus behandelt werden.
Impfung gegen RSV
Zurzeit gibt es noch keine aktive RSV-Impfung. Aktiv heißt, dass der gesunde Körper bei der Impfung gezielt mit Krankheitserregern in Kontakt gebracht wird. Bisher werden nur passive Impfungen verabreicht, bei denen dem Körper bereits fertige Antikörper gegen einen Krankheitserreger gespritzt werden.
Die passive RS-Virus-Impfung empfehlen Ärzt:innen für:
- Frühgeborene mit der Lungenerkrankung Bronchopulmonale Dysplasie (BPD)
- Kinder mit angeborenem Herzfehler unter zwei Jahren
- Frühgeborene, die vor der 35. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen sind
5. Aktueller Forschungsstand zum RS-Virus
Die wissenschaftliche Forschung hat in den letzten Jahrzehnten viele positive Entwicklungen hervorgebracht. Einige wichtige Neuerungen könnten den Ausbruch der RSV-Erkrankung in Zukunft verhindern bzw. die Schwere mindern.
So könnten passive Impfungen gegen RSV zum Beispiel das Risiko für Spätfolgen des RS-Virus, wie Asthma oder Allergien, reduzieren. Weitere Forschungsbemühungen konzentrieren sich auf die Entwicklung neuer Impfstoffe. Der Hersteller eines RSV-Impfstoffes für Menschen ab 60 Jahren bemüht sich derzeit (Stand: Juni 2023) bei der Europäischen Kommission um Zulassung. Der Impfstoff Arexvy besteht unter anderem aus einem sogenannten Fusionsprotein des RS-Virus, welches genetisch verändert wurde. Wenn dieses dem menschlichen Organismus zugeführt wird, regt es die Bildung von Antikörpern an.
Darüber hinaus ist es Forscher:innen gelungen, mithilfe sogenannter Fusionsinhibitoren zu verhindern, dass das RS-Virus mit den Lungenzellen verschmilzt. RSV-Infektionen konnten dadurch bei gesunden Erwachsenen vorgebeugt werden. Die Hoffnung ist, den Ansatz weiterzuentwickeln, um Medikamente zur Prävention von RSV-Erkrankungen herstellen zu können.
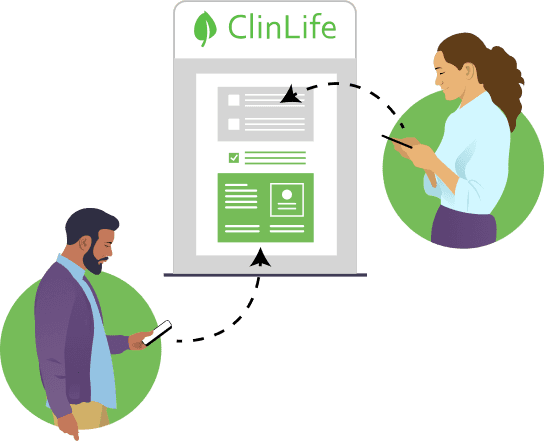
Über ClinLife
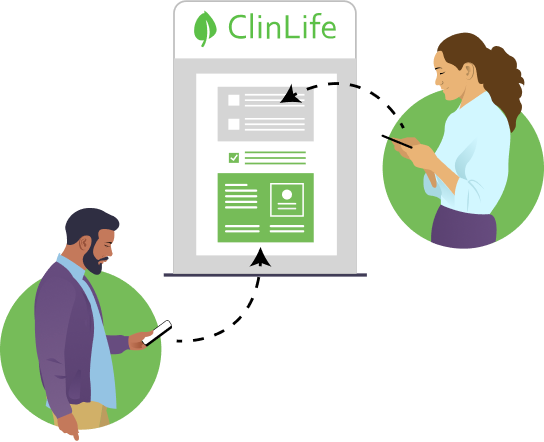
ClinLife ist eine für Patient:innen kostenlose Plattform, um auf sichere Weise passende klinische Studien zu finden und sich für diese zu bewerben. Ihre Datensicherheit und Privatsphäre sind dabei unsere höchste Priorität.
Weiter lesenUnser Datenschutz-Versprechen
- Ihre Daten werden nur gespeichert, wenn Sie Ihr Einverständnis zur Teilnahme an einer Studie geben.
- Nur die zertifizierten Studienärzte des von Ihnen gewählten Studienzentrums können Ihre Daten über unsere sichere Software einsehen.
- Wir geben Dritten keinen Zugang zu Ihren Daten und verkaufen sie unter keinen Umständen.